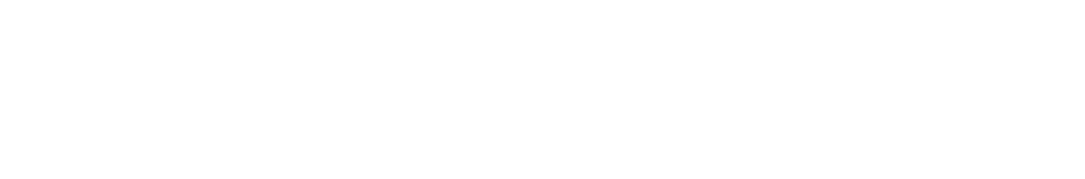Eine historische Chance für die Industrie und die EU, um gemeinsam zu profitieren
© WTO - Bryan Lehmann
2025 ist kein normales Jahr für den Welthandel. Neue Zölle, ein dichteres Netz an Sanktionen und ein spürbarer Anstieg geopolitischer Unsicherheiten bremsen den Fluss von Waren, Investitionen und Einkommen. Betroffen sind sowohl die Industrieländer als auch – noch stärker – die Schwellenmärkte.
Bereits im Frühjahr wurden die Wirtschaftsprognosen nach unten revidiert. Spätere Updates zeigten zwar kurzfristige Gegenbewegungen durch Vorzieheffekte, die strukturellen Hemmnisse blieben jedoch bestehen. Der CPB World Trade Monitor wies im zweiten Quartal rückläufige Monatswerte aus; die Wohlstandseffekte liegen deutlich unter früheren Vergleichswerten. Mit anderen Worten: Wir haben es weniger mit einem Nachfrageschock, sondern mit einem politisch induzierten Regulierungs- und Angebotsschock zu tun.
Für Unternehmen schafft dies ein reales ökonomisches Problem – mit unmittelbaren Folgen für das Tagesgeschäft, vor allem aber für langfristige Investitionen und Wachstumspläne, insbesondere in Auslandsmärkten.
Vielen Unternehmen fehlt der Zugang zu lokalem Wissen in Auslandsmärkten. Diese Unsicherheit schlägt sich zwangsläufig in einer negativen Investorenwahrnehmung nieder. Fehlen zusätzlich verlässliche Informationen über mögliche Investitionsoptionen oder Ambitionen eines Landes, bleiben viele Chancen ungenutzt.
Die zentralen Investitionsbarrieren in Entwicklungs- und Schwellenländern sind:
Politische und regulatorische Unsicherheit
Makroökonomische und finanzielle Beschränkungen
Unzureichende Infrastruktur
Markt- und unternehmerische Rahmenbedingungen
Schwache Governance und institutionelle Defizite
Begrenztes Humankapital und soziale Engpässe
Wahrnehmungs- und Informationslücken
Für ein Unternehmen erfordert die Bewältigung eines so breiten Spektrums an Herausforderungen beträchtliche Ressourcen, über die oft nur die größten Unternehmen verfügen. Das bedeutet, dass viele Unternehmen zwar an Investitionen im Ausland interessiert sind, jedoch aufgrund des hohen wahrgenommenen Risikos zögern.
Ein gut informierter und strukturierter Ansatz kann jedoch Risiken nicht nur abfedern, sondern echte Wettbewerbsvorteile schaffen. Anstatt von Ereignissen getrieben zu werden, können gut vorbereitete Unternehmen diese mitgestalten.
Die übersehene Chance: Handelserleichterungen
Eine vielfach unterschätzte Möglichkeit liegt in den Handelserleichterungen. Ironischerweise wird die Privatwirtschaft hier von der Gebergemeinschaft oft ebenso übersehen wie umgekehrt. Gemeinsam jedoch können öffentliche und private Akteure gezielte, wirtschaftlich relevante Projekte umsetzen, die echte Unterschiede machen.
Im Rahmen des Planungsprozesses sollte jedes Unternehmen, das in einen aufstrebenden Markt investieren möchte, sich über vorhandene Programme zum Kapazitätsaufbau im Handel und entsprechende Anknüpfungspunkte informieren. Handelserleichterungen verbessern nicht nur Prozesse, sondern schaffen ein Umfeld, das Investitionen anzieht und Wachstum fördert. Geplante Investitionen können exakt das sein, was Regierungen aktiv unterstützen möchten.
Handelserleichterungen sind kein „nice to have“, sondern das wirksamste und politisch tragfähigste Gegengewicht zu Zöllen, Sanktionen und Fragmentierung.
Das WTO-Abkommen über Handelserleichterungen (TFA)
Gibt es also einen Leitfaden für Handelserleichterungen, was zu tun ist und welche Auswirkungen dies haben kann? Die Antwort lautet: Ja, das WTO-Abkommen über Handelserleichterungen (Trade Facilitation Agreement, TFA).
2013 vereinbart und seit Februar 2017 in Kraft, verpflichtet es die Mitgliedsstaaten zu Reformen, die Bürokratie abbauen, Grenzprozesse verschlanken und Transparenz erhöhen sollen. Laut WTO reduziert eine vollständige Umsetzung die Handelskosten im Schnitt um 14 %, in Schwellenmärkten sogar deutlich mehr.
Kurz gesagt: Das TFA macht internationalen Handel effizienter und inklusiver – insbesondere für Entwicklungsländer, indem es Direktinvestitionen anzieht und Mikro-, kleine und mittlere Unternehmen (MSMEs) besser in internationale Märkte integriert.
Überschneidende Interessen
Die EU strebt resiliente Lieferketten, geringere Transaktionskosten, Digitalisierung an den Grenzen, Integrität in der Durchsetzung und die Einbindung kleinerer Unternehmen an – allesamt Ziele, die im TFA verankert sind.
Unternehmen wiederum wünschen Planungssicherheit, verlässliche Regeln, kurze Durchlaufzeiten, niedrigere Compliance-Kosten und Zugang zu neuen Märkten. Die Schnittmenge ist offensichtlich: Wer TFA-Reformen gemeinsam gestaltet, erprobt und skaliert, erzielt rasch messbare Fortschritte.
Genau hier setzt eine europäische Industrieallianz an – kofinanziert und politisch flankiert durch EU-Programme wie „Global Gateway“, kombiniert mit dem Praxiswissen der Unternehmen.
Von Lobbying zu Co-Creation
Anstelle klassischer Positionspapiere braucht es Co-Creation: gemeinsam definierte Problemstellungen, Pilotprojekte mit klaren KPIs (Baseline, Zielwert, Zeithorizont), Transparenz über Wirkungen und skalierbare Standards. Das ist kein Ersatz für Politik, aber eine Abkürzung zu besserer Handels- und Wirtschaftspolitik.
Praktisch bedeutet das:
Daten statt Meinungen: Median-Bearbeitungszeiten, Varianzen, Prüfquoten, Fehler- und Korruptionsindikatoren gehören in öffentliche Dashboards – validiert durch Dritte.
Digital First: Vorab-Abfertigung, risikobasierte Kanäle, E-Dokumente und schlanke Kontrollmechanismen reduzieren Reibungsverluste und Fehlerquellen.
Integrität by Design: Digitale Spuren, Whistleblowing-Kanäle, das Vier-Augen-Prinzip und unabhängige Prüfungen müssen integraler Bestandteil sein.
MSME-Einbindung: Schulungen, Onboarding-Standards und schlanke Zertifizierungen öffnen Märkte für viele – nicht nur für wenige.
Offene Standards statt Vendor Lock-In – nur so ist kosteneffiziente Skalierung möglich.
Die Wirksamkeit dieses Ansatzes ist erwiesen: Projekte der Global Alliance for Trade Facilitation (einer öffentlich-privaten Partnerschaft) beispielsweise führen seit Jahren zu erheblichen Zeit- und Kosteneinsparungen, von der Einführung von ePhyto bis hin zu Risikomanagement-Engines an den Grenzen. Im Logistikbereich haben Programme wie „GoTrade“ (DHL) dazu beigetragen, den bürokratischen Aufwand für KMU zu reduzieren.
Handlungsempfehlungen und Risikovermeidung
Wo liegen die Risiken für Unternehmen? Während Investitionen in Entwicklungsländern und Handelserleichterungen erhebliche strategische und wirtschaftliche Chancen bieten, müssen Unternehmen häufige Fallstricke vermeiden, die den Erfolg untergraben, den Ruf schädigen oder zu finanziellen Verlusten führen können. Hier sind 10 Leitlinien zur Minimierung von Risiken in diesem Bereich:
1. Gehen Sie nicht ohne fachkundige Unterstützung mit Zugang zu lokalen Partnern oder Informationen vor
Die Unterstützung durch anerkannte Experten für Politik und Regulierung mit Zugang zu regionalen und lokalen Akteuren hilft Ihnen, sich ein klareres Bild von der Situation vor Ort zu machen und die notwendigen Schritte zu erkennen, um das Risiko von Zeitverlust, zusätzlichen Kosten und im schlimmsten Fall sogar Misserfolg zu verringern.
2. Behandeln Sie es nicht wie CSR oder Philanthropie
Handelserleichterungen sind ein strategischer Faktor und nicht nur eine Geste des guten Willens. Vermeiden Sie symbolische Projekte, die nicht mit Ihren kommerziellen Zielen übereinstimmen. Integrieren Sie sie in Ihre Kerngeschäftsstrategie und konzentrieren Sie sich auf Ergebnisse, die wirklich einen positiven Unterschied machen. Setzen Sie sich realistische Ziele.
3. Gehen Sie nicht davon aus, dass es eine Einheitslösung gibt.
Jedes Land ist in Bezug auf seine regulatorischen, politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen einzigartig. Reformen, die an einem Ort erfolgreich sind, können an einem anderen Ort scheitern, wenn sie nicht angepasst werden.
4. Ignorieren Sie nicht die politische Ökonomie und die Machtverhältnisse.
Reformen können fest verankerte Interessen in Frage stellen. Machen Sie sich klar, wer vom Status quo profitiert, bevor Sie Änderungen vorschlagen.
5. Versprechen Sie nicht zu viel und liefern Sie nicht zu wenig.
Vermeiden Sie öffentliche Verpflichtungen ohne vollständige interne Abstimmung und Risikoanalyse. Vermeiden Sie außerdem „Banddurchschneidungen” zu Beginn, tun Sie das lieber am Ende. Glaubwürdigkeit ist wichtig.
6. Konzentrieren Sie sich nicht nur auf die Infrastruktur
Weiche Infrastruktur – wie Verfahren, digitale Systeme und Koordination – ist genauso wichtig wie physische Verbesserungen.
7. Vernachlässigen Sie nicht kleine Unternehmen und lokale Auswirkungen
Entwickeln Sie Reformen, die lokalen KMU und der lokalen Wirtschaft zugutekommen, um Inklusivität und Nachhaltigkeit zu gewährleisten. KMU können zur Unterstützung Ihrer Geschäftspläne sowie zum Wachstum der lokalen Wirtschaft beitragen.
8. Handeln Sie nicht in einem politischen Vakuum
Handelserleichterungen sollten mit der allgemeinen nationalen Entwicklungs- und Industriepolitik im Einklang stehen und dieser nicht widersprechen. Das ultimative Ziel ist es, das handelsbasierte Wachstum des Landes zu unterstützen.
9. Erwarten Sie keinen kurzfristigen ROI.
Reformen brauchen Zeit. Gehen Sie von einem Zeitraum von drei bis fünf Jahren aus, damit messbare Ergebnisse erzielt werden können und sich die Richtlinien etablieren können.
10. Ignorieren Sie Reputations- und ESG-Risiken nicht.
Führen Sie eine gründliche Due Diligence durch, um Verbindungen zu Korruption, Arbeitsrechtsverletzungen oder Compliance-Verstößen zu vermeiden. Auch hier sollten Sie sich von Experten mit nachweislicher Erfahrung in diesem Bereich unterstützen lassen.
Für die Umsetzung empfehlen wir eine pragmatische Partnerschaft in einem Konsortium mit Logistik-, Technologie- und Datenpartnern – mit einem klaren, EU-kompatiblen Mandat für die Konzeption, Erprobung und Skalierung.
Hier spielen Verbände eine Schlüsselrolle: Die ICC setzt Standards und bündelt internationale Best Practices, der BDI kann Anwendungsfälle koordinieren, Datenbeiträge organisieren und Pilotkorridore mit deutscher Industriekompetenz speisen. So wird aus „Dialog“ konkrete Umsetzung.
Dies ist kein Theoriepapier, sondern eine Einladung: vom „Positionieren“ ins „Pilotieren“ zu wechseln. Die EU hat die Tür geöffnet. Die Industrie stellt die Werkzeuge bereit. BOC Consult GmbH kann die Orchestrierung übernehmen – und binnen weniger Monate zeigen, dass Handelserleichterungen Investitionen beschleunigen, Wachstum fördern, Integrität sichern und Teilhabe ermöglichen.
#Handelserleichterungen #Wachstum #EU #Industrie #SupplyChains #FDI #KMU #BOC